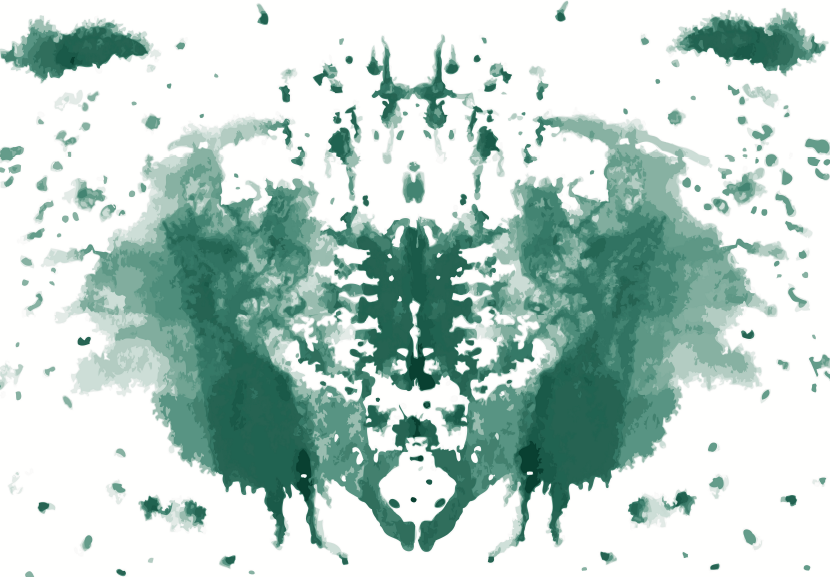Interview eines ASP-Mitglieds
Meret Fankhauser
Was waren Ihre Beweggründe, den Beruf einer Psychotherapeutin zu wählen?
Psychotherapeutin zu werden war zuerst einmal ein persönlicher Prozess. Das wohl einschneidendste Erlebnis für mich war der Umzug von einer Kleinstadt in ein Dorf. Ich war neun Jahre alt – gewohnt, alles mit links zu machen – und musste nun in der neuen Schule von Anfang an alles mit rechts ausführen. Ich verstand die Welt nicht mehr und fühlte mich alleine mit diesem Schock. Mir war nicht mehr wohl in meiner Haut. Ich hatte Mühe, mich am neuen Ort einzuleben, fühlte mich fremd, unpassend, draussen stehend. Meine Umwelt schien mit einer Watteschicht überzogen, wirkte irgendwie irreal. Ich hatte Schwierigkeiten, rechts richtig zu schreiben; vor allem die Orthographie stimmte weder mit meiner Handbewegung noch mit meiner visuellen Wahrnehmung überein. Die Schule wurde zur Last. Den Lehrer fürchtete ich, war er doch ein eher jähzorniger Mensch. Das alles überschattete meine weiteren Schuljahre. Ein Eintritt ins Gymnasium stand nicht zur Diskussion, zu einem guten Teil auch, weil ich ein Mädchen war. Ich besuchte die Bezirksschule und danach das LehrerInnenseminar, obwohl ich nie Lehrerin werden wollte. Und mit 20 Jahren unterrichtete ich die erste Schulklasse.
Erst mit 31 - ich hatte soeben eine Analyse nach C.G. Jung begonnen – wurde meine Linkshändigkeit zum Thema; ich hatte versucht, meine diffuse Wahrnehmung zu beschreiben. Die alten Gefühle waren sofort wieder da und ich ahnte, dass die damals entstandene Belastung nur in den Hintergrund gerückt, jedoch noch nicht aufgehoben war. Ich spürte, dass es nun Zeit war, etwas längst verloren Geglaubtes erneut zu finden. Ich fasste Vertrauen und Hoffnung und stellte mich der inneren Auseinandersetzung; die äusseren Umstände waren nicht ganz einfach, ich war nun verheiratet und zum 2. Mal schwanger. Doch mir war klar, dass ich erneut meinen roten Faden gefunden hatte. So begann ich mit einer Analyse und besuchte jedes Jahr ein Traumseminar. Das war ganz in den Anfängen der «Prozessorientierten Psychologie».
Diese neuen Erfahrungen waren so stark, dass sie in mir den Wunsch weckten, selbst Psychotherapeutin zu werden.
Was ist Ihr beruflicher Hintergrund/Werdegang?
Nach eineinhalb Jahren Lehrtätigkeit in Trimbach - mit 21 Jahren - reiste ich für sechs Monate als Au-pair nach England. Da sollte ich an der Sprachschule übungshalber zu einem frei gewählten Thema referieren.
Ich wählte C.G. Jungs autobiographisches Buch «Erinnerungen, Träume und Gedanken». Zu meiner Überraschung wusste die Sprachlehrerin, von wem ich sprach, und machte mich sogleich mit einem Kollegen bekannt, der Jung noch persönlich gekannt hatte; beide schienen sich zu freuen, dass endlich jemand aus der Schweiz wusste, wer C.G. Jung war!
Wieder zuhause besuchte ich den Vorkurs der Schule für Gestaltung. Während einer individuellen Vertiefung ins Malen erlebte ich zum ersten Mal einen «Flow»; der Begriff existierte damals noch nicht, doch die Erfahrung berührte mich. Da begann ich zu ahnen, dass mich seelische Prozesse weit mehr interessierten als die Kunst an sich, letztere stellte für mich lediglich ein Mittel dar.
Ein Psychologiestudium an der Uni lockte, doch dieses traute ich mir noch nicht zu. So absolvierte ich nach dem Vorkurs die Fachklasse, wurde Werklehrerin und begann kurze Zeit später mit Unterrichten in der LehrerInnen-Bildung. Ich heiratete einen Physiker, der am Jung-Institut studierte, gebar 3 Kinder und unterrichtete weiter ein Teilpensum. Mit 34 Jahren trennte ich mich von meinem Mann. Den Entscheid hatte ich mit Arnold Mindell (Gründer der «Prozessorientierten Psychologie») vorwärts und rückwärts durchbesprochen. «Yes, you can do it», war seine Antwort am Ende dieser Stunde. Dass Mindell diese Entscheidung mit mir trug, war wichtig, denn sie stärkte meine Hoffnung während schwieriger Jahre.
Mit minimalem Geld und ohne Festanstellung konnte ich in einer genossenschaftlich erstellten, kinderfreundlichen Siedlung ein Reihenhaus kaufen.
Ich unterrichtete weiterhin im Kunstbereich (noch weitere Jahrzehnte ohne Festanstellung) und entschied mich, gleichzeitig Psychologie zu studieren. Die kinderfreundliche Wohnsituation, vier Jahre mit Au-pair-Mädchen sowie die damals noch nicht so hohe Präsenzzeit an der Uni ermöglichten mir, neben meiner Lehrtätigkeit irgendwie alles unter einen Hut zu bringen. Acht Jahre später hielt ich das Lizentiat in Händen.
Das wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, das Feld zu wechseln und eine Stelle in einer psychiatrischen Klinik zu übernehmen. Leider musst ich feststellen, dass ich, trotz mehr als 20 Jahren Berufserfahrung, erneut bei Null hätte beginnen müssen; mit niederem Lohn und hoher Präsenzzeit.
So leichtfertig konnte und wollte ich meine Unterrichtsstelle jedoch nicht aufgeben. Deshalb suchte ich berufsbegleitend nach einem anderen Weg. Ich vertiefte meine therapeutischen Kenntnisse in «Prozessorientierter Psychologie» (auch Prozessarbeit genannt) und begann, mit ersten KlientInnen zu arbeiten. Bald fand ich bei einem Allgemeinpraktiker berufsbegleitend eine kleine Teilzeitstelle als Psychotherapeutin in Delegation; für einen Tag pro Woche. Da erlebte ich die Diskrepanz zwischen verantwortungsvoller Arbeit und künstlichem abhängig Werden.
Als drei Jahre später in der mir bekannten Prozessorientierten Praxis eine Lücke entstand, wechselte ich in diese Gruppenpraxis, allerdings ohne Delegation. Mein Brotberuf blieb weiterhin das Unterrichten. Für eine Praxisbewilligung und die Anerkennung der «Tarifsuisse» fehlte mir unter anderem der Abschluss in Psychopathologie. Dass ich auch die Therapieausbildung nie ganz abgeschlossen hatte, wurmte mich sehr, war ich doch schon jahrzehntelang Teil einer therapeutischen Intervisionsgruppe.
Zehn Jahre später, im Wissen um eine baldige Pensionierung in der LehrerInnen-Bildung, entschied ich mich, das Fehlende noch abzuschliessen. Ich bestand die Prüfungen in Psychopathologie und Pharmakologie und beendete auch meine therapeutische Ausbildung in Prozessorientierter Psychologie.
Und jetzt? Ja, es gibt KlientInnen mit einer Zusatzversicherung. Doch diese KlientInnen müssen – je nach Versicherer – noch immer einen grossen Teil der Kosten selbst tragen. Selbst bei Unfallversicherungen braucht es oft juristisches Geschick, damit diese sich nicht aus der Verantwortung stehlen.
Arbeiten Sie als selbständige Psychotherapeutin in freier Praxis und/oder sind Sie zusätzlich noch als delegierte Psychotherapeutin tätig?
Sehr gerne möchte ich selbständig arbeiten, doch die bestehenden Rahmenbedingungen lassen es nur in sehr engem Rahmen zu. Obschon ich nun alle Bedingungen erfülle und mehr als genügend Anfragen habe, kann ich kaum arbeiten.
Im Moment bin ich dabei, mit einer Psychiaterin eine Teildelegation einzufädeln. Allerdings belasten mich die damit verknüpften Bedingen zusehends. Muss ich wirklich all die Bevormundung schlucken, die mit der Delegation einherzugehen scheinen? So erlebe ich als «Späteinsteigende», dass nicht die Qualität der Leistung zählt, nicht einmal die Papiere, sondern eben, ob man die kränkende Hierarchisierung und die vielschichtige zusätzliche Administration, die ja auch kostet, verbunden mit sozio-ökonomischer Enge, erträgt.
Gibt es noch einen weiteren Beruf, eine weitere Beschäftigung, den/die Sie zusätzlich zur Psychotherapie ausüben?
Nur zu gerne wäre ich viel früher ganz auf die Psychotherapie umgestiegen. Da ich im therapeutischen Feld keine Möglichkeit finden konnte, meine Existenz und teilweise jene der Kinder zu bestreiten, blieb ich weiterhin im Bildungsbereich tätig. Da behielt ich den Fokus auf dem Unterrichten von Kunst. Auch im Bildungsbereich gibt es zahlreiche Gelegenheiten, den Prozess der eigenen Ressourcen anzukicken, insbesondere im Kunstbereich. Zusätzlich durfte ich diesen reichen Boden durch «Learning Through The Arts» während eines Bildungsurlaubs in Kanada vertieft erkunden. Seither sind Themen der Entwicklung, der Lernmotivation und Identität für mich ein zentraler Forschungsgegenstand.
Der LehrerInnen-Bildung bin ich somit treu geblieben. Die Prozessarbeit half mir jedoch während all der Jahre, meine innere Orientierung beizubehalten. Da mich die teilweise Überschneidung von therapeutischen Prozessen mit jenen der Suche nach gestaltetem Ausdruck faszinieren, besuchte ich 2001/2002 in Saas Fee die zwei Sommerseminare in «Advanced Graduate Studies in Expressive Arts». Danach wollte ich, unter der Leitung von Jürgen Kritz, einen entsprechenden PhD in Angriff nehmen. Doch die Gründung der Pädagogischen Hochschule Zürich, in die die Vorgängerseminare überführt wurden, stellte erhöhte Ansprüche, so dass es beim schönen Traum und der Erinnerung an interessante Begegnungen blieb.
Wenn ja, was sind hierfür die Beweggründe?
Durch das Unterrichten konnte ich einen Teil meines Interesses an Menschen abdecken. Doch, wer plant schon, alleine drei Kinder aufzuziehen? Die Rahmenbedingungen dazu waren und sind in der Schweiz extrem schwierig. So hatte ich das Thema «Alleinerziehend» Ende der 80-er Jahre für meine Lizentiatsarbeit gewählt: Ich zeigte darin auf, welche Faktoren die sozio-ökonomische Lage einer Frau mit Kindern bedrohen, selbst wenn sie über gute berufliche Qualifikationen verfügt. Eine Journalistin hatte damals aus meiner Arbeit eine Seite für den Tages-Anzeiger erstellt. Dieser lehnte den Text ab, das Thema sei zu heiss.
Was ist Ihre Spezialisierung?
Mich fasziniert die Arbeitsweise der Prozessarbeit noch immer. Zusätzlich vertiefe ich mich nun in die Trauma-Arbeit; EMDR und Lifespan Integration. Auch habe ich Erfahrung mit Gruppendynamik und Supervision. An pädagogischen Fragen interessiert mich das Wecken von Neugier und damit verbunden die Lernmotivation.
Fühlen Sie sich mit Ihrer beruflichen Situation zufrieden?
Mit der konkreten Arbeit, ja; doch die Arbeitsbedingungen für PsychotherapeutInnen finde ich schlicht unakzeptabel. Ohne Delegation reiste ich oft für eine einzelne Stunde in die Praxis. Das beelendete mich: Meine Einnahmen waren kaum grösser als die Ausgaben. Und jetzt, wo ich Delegation am Einfädeln bin, belastet mich die damit verbundene Administration, denn sie steht einer ebenbürtigen Kooperation weitgehend im Wege.
Gibt es etwas, das Sie sich anders wünschen?
Ja, natürlich: ein Psychotherapiegesetz, das uns TherapeutInnen die vielen Aus- und Weiterbildungen – zusätzlich zu einem Uni - Psychologiestudium – anrechnet und uns mit PsychiaterInnen ebenbürtig arbeiten lässt. Es darf nicht sein, dass die konkrete therapeutische Arbeit von den Kassen so viel schlechter bezahlt wird als jene der PsychiaterInnen. Wie wäre es mit einem Vergleich von Ausbildung, Weiterbildung und Arbeitsweise der beiden Berufe?
Und warum wird im Gesundheitssystem Psychotherapie nur als Kostenfaktor gesehen? Verschwiegen werden jedoch die positiven Wirkungen, sei es die Einsparung durch weniger Medikamente, weniger Arztbesuche, vermutlich auch weniger OPs und der guten Langzeitwirkung; ganz abgesehen von den durch Psychotherapie kaum entstehenden Langzeitschäden. Auch die vom ASP mit viel Aufwand durchgeführte Studie belegt, dass Psychotherapie nachhaltiger und letztendlich kostengünstiger arbeitet als die Pharma-«Therapie». - Warum darf sich das Gesundheitssystem einfach über diese Resultate hinwegsetzen?
Gibt es etwas, das Sie sich von Ihrem Verband ASP wünschen?
Es wäre schön, wenn der Verband ASP genauer hinschauen würde, in welch prekären sozio-ökonomischen Umständen PsychotherapeutInnen leben – oft fast ohne Rücklagen für eine Altersvorsorge – und er entsprechend mithelfen würde, nach Lösungen zu suchen, die auch der kostspieligen Aus- und Weiterbildung von Psychotherapeutinnen gerecht werden.
Fühlen Sie sich in Ihrem Berufsverband ASP vertreten und gewürdigt?
Auf menschlicher Ebene habe ich im ASP Gehör gefunden, doch erkenne ich kaum Anstrengungen, die prekäre Berufssituation von heutigen PsychotherapeutInnen zu verbessern.
Was wäre Ihr Fokus, wenn Sie im Vorstand der ASP wären?
Netzwerke aufbauen; zwischen Kliniken, dem Verband der PsychiaterInnen und jenem der PsychotherapeutInnen. Zudem gilt es, nach Wegen zu suchen, wie weitere Gruppenpraxen entstehen können. Nur in ganz seltenen Fällen höre ich von PsychotherapeutInnen, dass Ihre Arbeitssituation gut ist. Weit mehr höre ich von Verrenkungen, Zusatzleistungen und Selbsthilfeaktionen, welche delegiert arbeitende PsychotherapeutInnen vollbringen, nur um arbeiten zu können. Das kann doch nicht die Lösung sein für einen ganzen Berufsstand, welcher Menschen unterstützen will, auf eigenen Beinen stehen zu lernen!
Gibt es ein Amt in der ASP, das Sie gerne bekleiden würden?
Nicht wirklich. Ich möchte in meiner dritten Arbeitsphase ganz gewöhnlich therapeutisch arbeiten. Mich interessieren auch die sogenannt «hoffnungslosen Fälle»; was ist es, das sie die Hoffnung so aufgeben lässt?
Wie sähe Ihre Wunschsituation im gegebenen politischen Umfeld für PsychotherapeutInnen aus?
Ich wünsche mir eine kooperative Zusammenarbeit zwischen PsychiaterInnen, allgemein praktizierenden ÄrztInnen und Psychotherapeutinnen. Für PsychotherapeutInnen mit Praxisbewilligung gehört die Delegation abgeschafft. Sie mag einzig für Therapeutinnen in Ausbildung noch eine Berechtigung haben. So könnten jedenfalls Ausbildungsplätze geschaffen werden. Den grössten Bedarf sehe ich bei Arbeitsplätzen für angehende Kinder-TherapeutInnen.
Die bestehende Krux mit den Kassen überschattet unsere Arbeit. Sie untergräbt nicht nur die sogenannte «freie Marktwirtschaft», sie erzeugt auch falsche Reize. Das Gesundheitssystem scheint heute den Heilungsprozess alleine der Technik zu überlassen. Statt Kooperation werden unmenschliche Hierarchien und Abhängigkeiten erzeugt. Und die Versicherten entwickeln die Haltung, eben alles zu beanspruchen, was geht. Doch so kann das Gesundheitssystem längerfristig nicht funktionieren.
Was ist Ihre Vision in Ihrem beruflichen Alltag?
Ich beobachte, wie suchende Menschen diverse (auch therapeutische) Schulungen absolvieren, immer in der Hoffnung sich selbst kurieren zu können. Erst eine Diagnose oder ein spezifisches Leiden bringen sie dazu, sich persönlich mit ihrer Psyche auseinanderzusetzen, Therapie in Anspruch zu nehmen. Hier braucht es ein niederschwelliges Angebot, eben in Kooperation mit Medizinern.
Ein weiteres Thema, das auf uns als Gesellschaft zukommt, ist die zunehmende Flüchtlingswelle. Vielleicht ist da ein Vorstoss von unserer Seite notwendig, damit die Flüchtlinge nicht nur herumgeschoben werden, sondern auch eine erste seelische Hilfe erfahren. Dadurch kann, wie wir ja wissen, Traumatisierungen zumindest teilweise vorgebeugt werden. Das Thema beschäftigt mich. Noch weiss ich nicht, wie wir vorgehen könnten. Doch ich denke, wir sollten uns da einschalten.
Meret Fankhauser, lic. phil., Uster
dipl. prozessorientierte Psychotherapeutin
Mitglied in der ASP seit 2014
Die Fragen stellte Veronica Baud