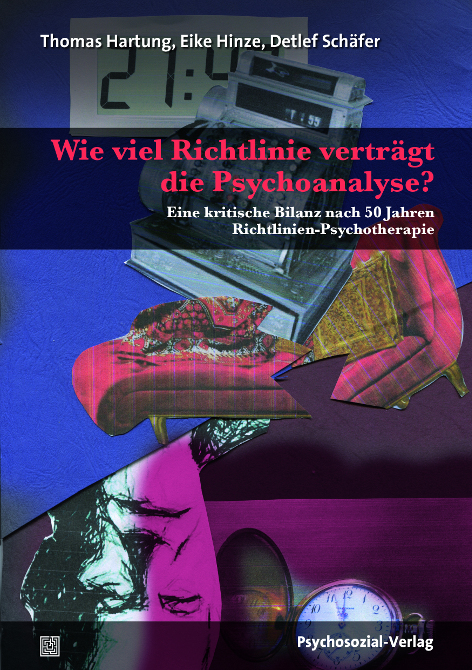
Wie viel Richtlinie verträgt die Psychoanalyse?
Eine kritische Bilanz nach 50 Jahren Richtlinien-Psychotherapie
Veronica Baud
Thomas Hartung, Eike Hinze,
Detlef Schäfer
Buchreihe: Bibliothek der Psychoanalyse, Verlag: Psychosozial-Verlag, 139 Seiten, Broschur, 148 x 210 mm, Erschienen im Februar 2016, ISBN-13: 978-3-8379-2458-9, Bestell-Nr.: 2458
Das Autorentrio Thomas Hartung, Eike Hinze und Detlef Schäfer setzt sich in seinem Gemeinschaftswerk mit einem auch für Schweizer Psychotherapeuten/-innen sehr aktuellen Thema auseinander, wenn es das Spannungsfeld zwischen psychoanalytischer Praxis und den gesetzlichen Vorgaben durch die Krankenversicherer untersucht. Anlass dafür gibt das 50-jährige Jubiläum der Anerkennung der Psychotherapie als Leistung der gesetzlichen Krankenkassen und der damit verbundenen Einführung der Psychotherapie-Richtlinien. Dabei liegt der Fokus entsprechend der psychotherapeutischen Ausrichtung der drei Autoren auf der Psychoanalyse und den tiefenpsychologisch orientierten Schulen. Dazu ist zu bemerken, dass in Deutschland ausser der Verhaltenstherapie nur noch diese beiden Psychotherapie-Ausrichtungen ihre Leistungen über die Krankenkasse verrechnen können. Da die Verhaltenstherapie ihren Schwerpunkt mehr auf Kurzzeittherapien legt, geraten die beiden anderen Orientierungen in Deutschland stärker in den Fokus der Krankenkassen und den Generalverdacht, kostspielige Langzeittherapien mit einem zweifelhaften Nutzen für die Patienten/-innen zu praktizieren. Mit diesem Vorwurf und mit dem, was dieser Vorwurf mit den Psychoanalytikern/-innen macht, setzen sich die drei Autoren auseinander. Dabei hat jedes Kapitel eine eigene Literaturliste und eine übersichtliche Struktur.
Der oben genannte Vorwurf wird bereits von Eike Hinze in seiner Einführung entkräftet: Eine Studie von 2009 hat nämlich gezeigt, dass selbst Psychoanalytiker, denen eine hochfrequente Psychoanalyse mit einem Stundenkontingent von 160 Stunden zugesprochen wurde, dieses in 75% der Fälle nicht ausschöpften.
In seinem der Einführung folgenden Kapitel über «Das Honorar des Psychoanalytikers» setzt er sich noch differenzierter mit den Finanzierungsmodalitäten in der Psychoanalyse auseinander. Dabei geht er von Freuds Praxis aus und zeichnet die Entwicklung des Verhältnisses der Psychoanalytiker zu ihrem Honorar im Laufe der nachfolgenden Jahre nach. Hier geht er der bis heute andauernden psychoanalytischen Diskussion auf den Grund, dass es für den psychoanalytischen Prozess wichtig ist, die Analysandin bezahlt ihre Analyse selber und wird nicht durch eine Krankenkasse fremdfinanziert. Diese These hält er für nicht erwiesen und sieht Vor- und Nachteile für beide Modalitäten.
Detlef Schäfer setzt sich in dem daran anschliessenden Kapitel mit dem Verhältnis der Krankenversicherung und der Psychoanalyse auseinander. Zu Beginn erläutert er einerseits die Entwicklung der Psychoanalyse und andererseits diejenige der Krankenkassenversorgung. In diesem Zusammenhang befasst er sich mit den verschiedenen Rollen, die der Psychoanalytiker in seinem berufspolitischen Umfeld einnimmt. Ein Faktor, an dem sich das Ringen der Psychoanalytiker mit den gesundheitspolitischen Veränderungen besonders deutlich zeigt, ist die Frequenz. Seit dem Inkrafttreten der Psychotherapie-Richtlinien von 1993 sind nur noch 3 Sitzungen pro Woche genehmigt, was in der Settingfrage zu grossen Differenzen geführt hat. In seinem Resümee bleibt Schäfer etwas unkonkret, wenn er fordert, dass die Psychoanalytiker sich zwar den neuen Entwicklungen des Gesundheitssystems nicht entziehen dürfen, aber dennoch ihren eigenen Prämissen treu bleiben sollten. Hier hätte man sich etwas klarere Aussagen gewünscht, wie das aussehen könnte.
In dem darauffolgenden Kapitel zeichnet Detlef Schäfer die Entwicklung der Psychotherapie-Richtlinien nach, wobei er im Jahr 1967 beginnt, als die Psychotherapie in die Krankenkassenleistungen aufgenommen wurde. Hier setzt er sich einerseits mit dem Wandel des Krankheitsmodells und andererseits mit den Vorgaben für die verschiedenen Methoden auseinander. Auch am Ende dieses Kapitels plädiert er dafür, dass sich die Psychoanalytiker mit ihrem Behandlungskonzept ihren Platz in den Richtlinien sichern müssen, ohne sich dabei selber zu verleugnen. Auch hier klingt sein Plädoyer etwas resigniert angesichts der gesundheitspolitischen Entwicklungen, die immer stärker auf Effizienz und Wirtschaftlichkeit abzielen.
In den nachfolgenden Kapiteln beschäftigt sich Thomas Hartung mit dem Einfluss und den verschiedenen Perspektiven der in dem Spannungsfeld zwischen Psychoanalyse und Psychotherapie-Richtlinien stehenden Protagonisten wie: Analytiker, Analysand, Ausbildungskandidaten, Supervisor und Richtlinienvertreter, wobei er die jeweilige Perspektive einnimmt und teilweise mit Fallvignetten zur Veranschaulichung arbeitet. Dabei kommt er zu dem Schluss, dass zumindest seine eigene Auseinandersetzung mit den Richtlinien dazu geführt hat, eine innere Unabhängigkeit zu finden. Es besteht für ihn aber auch die Gefahr, dass die Begrenzung in der Behandlung dazu verführen könnte, unbequeme Patienten schneller los zu werden. Jedoch sieht er auch klare Vorteile für die Patienten/-innen, deren finanzielle Situation durch die Übernahme der Behandlungskosten durch die Krankenkasse deutlich entlastet wird. Vor allem die Beschäftigung mit den Ausbildungskandidaten und Supervisoren zeigt, dass in Deutschland das Ausbildungssystem deutlich reglementierter ist als in der Schweiz. Hier werden den Ausbildungskandidaten sowie den Supervisoren genaue Stundenzahlen und deren Frequenz pro Woche vorgeschrieben. Dies führt zu einem rechten Leistungsdruck, wollen beide ihre Vorgaben im dafür angesetzten Zeitrahmen schaffen. Es liegt auf der Hand, dass dies einen nicht unerheblichen Einfluss auf die jeweilige berufliche Tätigkeit hat. Bei der Auseinandersetzung mit den Richtlinienvertretern weist Hartung auf ein erstaunliches deutsches Phänomen hin, das seinen Eingang in die Psychotherapie-Richtlinien gefunden hat: Es darf nur eine hochfrequente Analyse begonnen werden, bei der innerhalb mindestens 160 Stunden, längstens 240 Stunden, ein Erfolg abzusehen ist; sollte dies nicht der Fall sein, darf die Analyse auch nicht in Eigenfinanzierung fortgesetzt werden. Offenbar ist dieser eigenartige Passus in den Richtlinien ein Versuch der Versicherer, eine gewisse Kostenlimitierung zu erreichen, die jedoch nicht offen ausgesprochen werden darf, da in Deutschland gemäss dem Naturleistungsprinzip dem Patienten keine ausreichende, vollständige Behandlung – was auch immer das ganz genau sein soll – versagt werden darf. In der Praxis scheint dieses Phänomen zu einem Kompromiss zwischen Analytikern und Krankenkassen zu führen, wonach vor allem niedrigfrequente psychoanalytisch orientierte Psychotherapien bewilligt werden, die letztendlich zeitlich kaum limitiert werden. Ein Phänomen, das, wie Hartung bemerkt, verständlicher Weise dazu führt, dass viele Psychoanalytiker auf ein hochfrequentes Setting verzichten und damit eine wichtige psychoanalytische Behandlungsform immer mehr aufgeben.
Im letzten Kapitel setzt sich Hinze mit dem Phänomen auseinander, dass aus den Psychotherapie-Richtlinien der Begriff «Psychoanalyse» gestrichen wurde und mit dem schwammigeren Begriff der «analytischen Psychotherapie» ersetzt wurde. Letzteres scheint zunehmend von der klassischen Psychoanalyse losgelöst zu werden, die als Negativbeispiel für endlose hochfrequente Analysen bestehen bleibt. Am Schluss dieses Kapitels kommen endlich konkretere Forderungen: Es braucht mehr psychoanalytische Studien über die Wirksamkeit der Methode und einen öffentlichen Diskurs über psychoanalytische Verfahren, um der Skepsis der Krankenkassen und der Richtlinienvertreter zu begegnen.
Das Werk der drei Autoren ist sehr lesenswert, umso mehr, als das Thema in der aktuellen Diskussion um das schweizerische Anordnungsprinzip sehr viel Brisanz hat, auch wenn es hier um die deutsche berufspolitische Situation mit Fokus auf die Psychoanalyse geht. Die Phänomene, die dort beschrieben sind, beschränken sich ja nicht nur auf diese Therapierichtung, sondern sind wohl auch vielen anderen Psychotherapieschulen bekannt. Auch kann es hilfreich sein, hier Trends abzulesen, die auch in der Schweiz bemerkbar sind bzw. noch kommen könnten.
Das Buch ist sehr gut lesbar und übersichtlich, verliert sich nicht zu stark in psychoanalytischem Fachjargon, sodass es auch von Nicht-Analytikern gut gelesen werden kann.
Teilweise wirken die Resümees etwas resigniert, wie es sich immer wieder in der psychoanalytischen Literatur finden lässt. Dann fürchtet man wieder einen beleidigten Rückzug in den Elfenbeinturm, aber gerade das Schlusswort von Eike Hinze lässt hoffen, dass ein konstruktiverer Weg angestrebt wird.
Veronica Baud
Leiterin Psychotherapie
Spital Affoltern am Albis