Jeannette Fischer (2018):
Angst – vor ihr müssen wir uns fürchten
Basel: Stroemfeld/Nexus, ISBN 978-3-8610-9205-6,
208 Seiten, 31.90 CHF, 24.00 EUR
à jour! Psychotherapie-Berufsentwicklung 7 (14) 2021 38–39
https://doi.org/10.30820/2504-5199-2021-2-38b
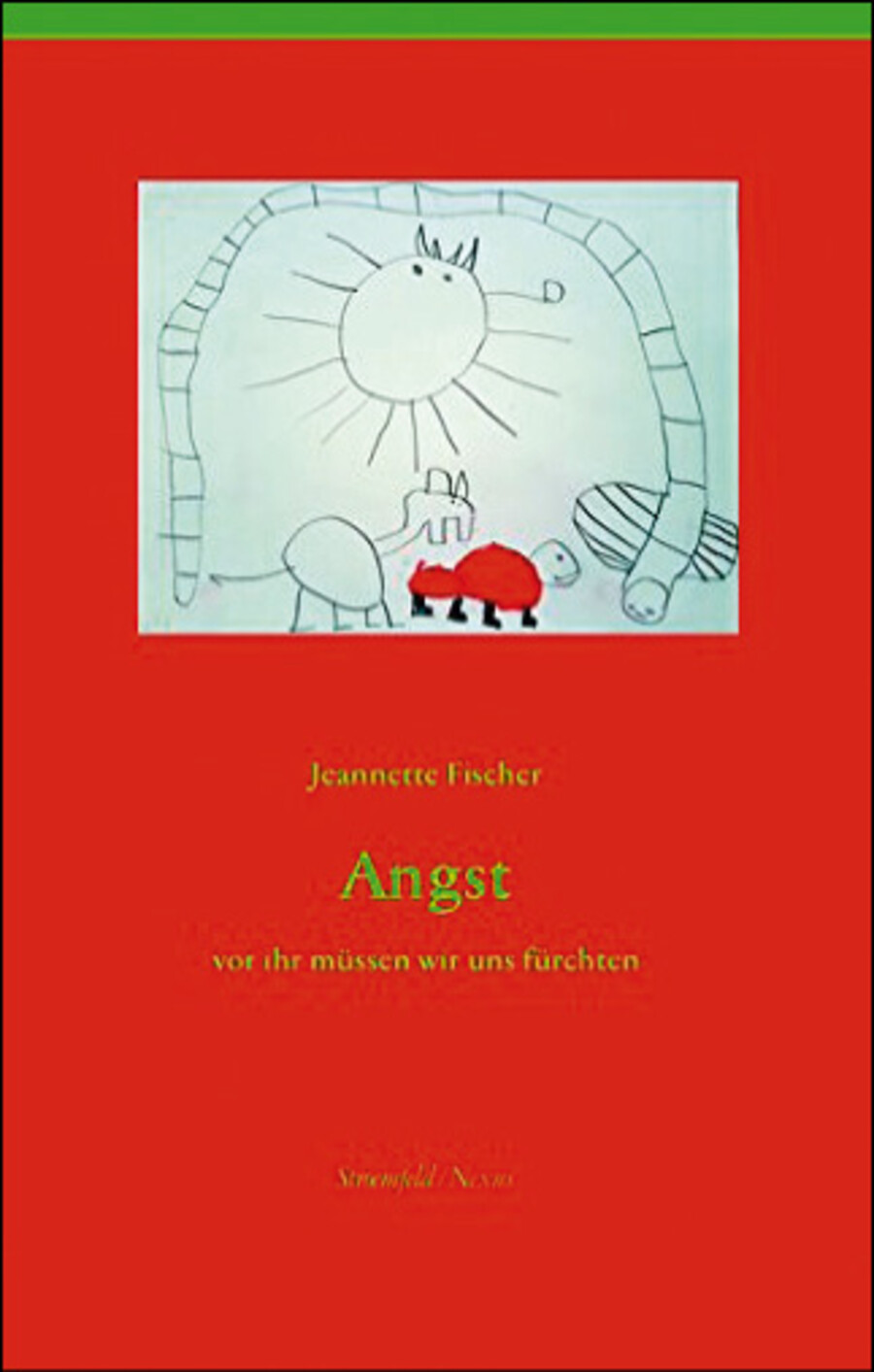
Die Zürcher Psychoanalytikerin Jeannette Fischer legt mit diesem Buch ein differenziertes Essay über die Rolle der Angst in Beziehungen und in unserer Kultur vor. Sie nennt es ein psychoanalytisches und allgemeinverständliches Sachbuch über die Angst. Es ist ein fulminantes Plädoyer zur Abkehr von hierarchischen Beziehungen hin zu einem intersubjektiven Raum, in dem Menschen sich auf gleicher Ebene begegnen und als jeweils andere akzeptieren.
Sie sieht Angst ausschliesslich als Bindemittel in hierarchischen Beziehungen und bestreitet die gängige Annahme, dass Angst ein Gefühl ist, ein lebensnotwendiges Gefühl, das uns vor Gefahren schützt. Fischer gibt den Leser*innen vielmehr Einblick in deren Wichtigkeit und Unentbehrlichkeit für die bestehenden Machtverhältnisse. Es sei nicht die Angst, die uns vor Gefahren schützt, es sei die Furcht. Diese beiden Begriffe gelte es auseinanderzuhalten. In der Furcht haben wir keine Angst: Die Aggressionen im Dienste des Ichs bleiben dabei unbeschädigt. Damit kommt der Angst eine ganz andere Bedeutung zu: Sie ist nicht Indikator für eine bevorstehende Gefahr, sondern eine bestehenden Form von Gewalt, mit der Hierarchien geschaffen und Machtverhältnisse eingerichtet werden. So sagt Fischer denn, dass es die Angst ist, vor der wir uns zu fürchten brauchen.
Die Autorin illustriert dies an Beispielen aus der Kindererziehung, der Mutter-Kind-Beziehung und an Beispielen aus der klinischen Praxis. Viele Störungsbilder lassen sich erklären durch biografische Erfahrungen von Schuld und Strafe bei Nichtbefolgen elterlicher und gesellschaftlicher Gebote. Angst wird stets verstanden als Angst vor, Angst dass. Das Nicht-Erfüllen von Erwartungen wird mit abweisenden oder entwertenden Konsequenzen bestraft, wovor Kinder (und Erwachsene) Angst haben. Man kann das auch vergleichen mit bedingter Liebe, bei der Anerkennung dann erfolgt, wenn die Bedingungen erfüllt werden, als Gegenstück zu einer unbedingten Liebe, bei der man Anerkennung und Liebe bekommt, einfach weil man da ist, weil man ist, wie man ist.
Angst sei eine Reaktion auf Gewalt, eine Empfindung der Ohnmacht, in der man seiner konstruktiven Kräfte beraubt sei. Schuld gegenüber dem Verbündeten wird zu Angst. Angst könne nicht unabhängig dieser Zusammenhänge gesehen werden. Sie dürfe nicht als psychische Störung eines Individuums pathologisiert und in Einzeltherapien behandelt werden, sondern sei als Ausdruck eines Herrschaftsdiskurses zu lesen, an dem wir alle teilhaben und teilnehmen. Wer diesen verlässt dem*der droht der Ausschluss aus der Gemeinschaft und damit Einsamkeit. Dem Herrschaftsdiskurs stellt die Autorin den intersubjektiven Diskurs als Alternative gegenüber, in dem der*die andere als anders, als Nicht-Ich anerkannt und gerade wegen dieser Differenz zum Ich geschätzt wird. Dies sei das einzig Verbindende unter Menschen und in der Gesellschaft. Alles andere sei Teil eines Gewaltdiskurses. Viele Beispiele illustrieren dies: Angst vor der Prüfung etwa antizipiert das Scheitern. In der Angst wird der Erfolg ausgeschlossen. Angst trennt, trennt das Subjekt von sämtlichen Beziehungen, von der Welt. Angst wird durch Introjekte aus Beziehungserfahrungen genährt.
Der Opferdiskurs ist ein aggressiver Diskurs. Das Opfer richtet in der Beziehung ein hierarchisches Gefälle ein, um Kontrolle und Macht über das Gegenüber zu erlangen. Schuld ist das Bindemittel solcher Beziehungen: Deinetwegen geht es mir so schlecht, leide ich so sehr. Viele Kinder kennen solche Botschaften ihrer Mütter oder von anderen Bezugspersonen.
Das Buch ist reich an Beispielen aus unterschiedlichen Lebenssituationen und der klinischen Praxis, die viele Gelegenheiten zur Reflexion des Beziehungsgefüges unter dem Aspekt eines Herrschaftsdiskurses gegenüber einem intersubjektiven Diskurs bieten. Sie regen auch zur Selbstreflexion der Leser*innen an, wie man selbst in Beziehungen steht. Anhand eines Fallbeispiels erläutert die Autorin, wie Schuld auch die sexuelle Beziehung beeinträchtigt und das Begehren entschärft. Wenn Hingabe zur Selbstaufgabe wird, gibt es keinen intersubjektiven Diskurs mehr und so erlischt auch die sexuelle Attraktion. Gesellschaftlich kritisch sieht sie die Ehe als Versuch, zwischen der Kontrolle des Begehrens und der institutionell bezeugten Sicherung der Beziehung eine Verbindung herzustellen.
Mir gefällt an diesem Buch die Verbindung von psychoanalytischem Denken, klinischer Reflexion und der politisch-gesellschaftlichen Ebene. Solche klinische Literatur ist selten geworden in einer Zeit, in der Psychotherapie vor allem auf die möglichst effiziente Behandlung von Störungen im Individuum ausgerichtet ist, zwecks Anerkennung als Verfahren zulasten der Krankenversicherungen.
So spannend und vielseitig das Buch geschrieben ist – und wirklich auch verständlich für Personen, die nicht psychoanalytisch geschult sind –, so soll doch auch ein Wort zu seiner Gliederung gesagt sein: Diese ist unübersichtlich. Das gut 200-seitige Buch weist kein Inhaltsverzeichnis auf, das einem die Orientierung erleichtern würde. Es gibt zwar immer wieder Untertitel im Text, das Buch liest sich aber wie aus einem Fluss geschrieben, als sei die Autorin beim Schreiben etwas atemlos gewesen und sei so von einem zum nächsten Punkt gekommen, eben wie ein Essay geschrieben ist. Ein Sachbuch hat in der Regel eine übersichtlichere Struktur und Gliederung. Das macht das Lesen von Fischers Buch etwas anstrengend und zeitweise ermüdend, insbesondere da so auch viele inhaltliche Wiederholungen zustande kommen. Man hätte dem Buch und der Autorin ein etwas strengeres Lektorat gewünscht, das nicht nur die Sprache, sondern auch die Konzeption und Gliederung im Auge behält. Dennoch: Gern empfehle ich dieses Buch zur Lektüre.
Peter Schulthess