Jeanette Fischer (2021): Hass
Frankfurt/M.: Klostermann/Nexus, ISBN: 978-3-465-04542-7,
160 Seiten, 26.80 CHF, 22.80 EUR
à jour! Psychotherapie-Berufsentwicklung 8 (15) 2022 41–41
https://doi.org/10.30820/2504-5199-2022-1-41
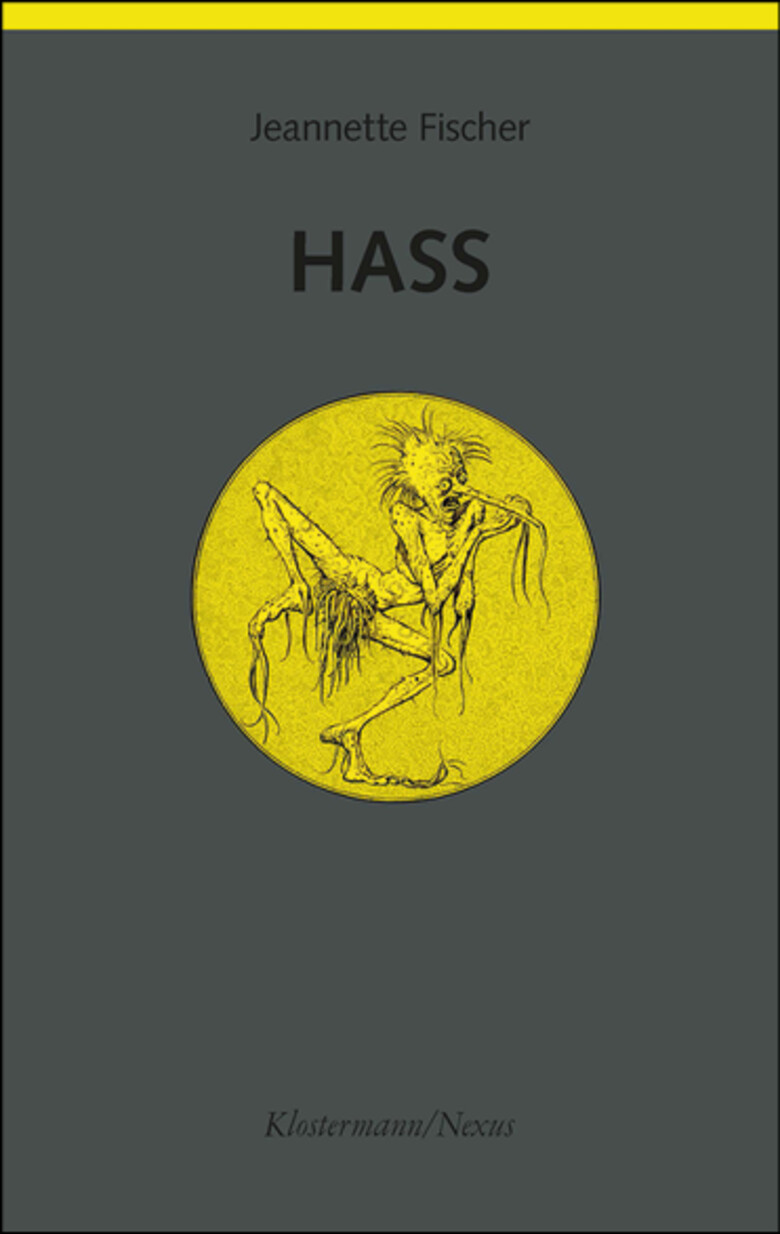
Die Zürcher Psychoanalytikerin Jeanette Fischer legt mit diesem Buch über «Hass» ein weiteres essayistisch angeordnetes psychologisches Sachbuch vor, das lesenswert ist. Sie führt darin ihre Überlegungen zum Opfer-Täter-Diskurs aus ihrem Buch Angst1 weiter und erläutert, wie biografische, symbiotische Mutterbindungen aus diesem Diskurs heraus zu Hass, Selbsthass und letztlich zu einem Potenzial zum Morden führen können.
Hierarchische Mutter-Kind-Beziehungen laufen oft so, dass das Kind verantwortlich gemacht wird für die Leiden der Mutter, es wird zum Opfer, die Mutter zur Täterin, kaschiert als Mutterliebe. Das Kind versucht das Möglichste, um der Mutter zu helfen, erlebt aber aus Überforderung und Ohnmacht, dass es das nicht schafft, und wird entsprechend als unnütz abgestraft. Der projizierte Hass der Mutter auf das Kind wird internalisiert, das Kind identifiziert sich damit und entwickelt einen Hass auf sich selbst für seine Ohnmacht, da es sich nicht leisten kann, die Mutter zu hassen, da es von ihr abhängig ist. Im Opfer-Täter-Diskurs geht es um Schuld. Um sich von der Schuld, die das Kind auf sich genommen hat, und der Ohnmacht, nicht geholfen haben zu können, zu befreien, kann es zu Selbsttötungen oder gar Morden und Massenmorden kommen, wo das vom Opfer der Mutter zum Täter, zur Täterin an Dritten mutierte erwachsene Kind sich rächen kann und legitimiert ist zur eigenen Selbstverteidigung, andere aus Hass zu töten. Die Einrichtung von Sündenböcken, die man dann legitimerweise und ohne Schuld töten darf, hilft der Schuldverringerung und stabilisiert das eigene Ich.
Das Buch enthält eine herausfordernde Kritik an dem in unserer Kultur verherrlichten Mutterbild, das den oft vorhandenen Machtmissbrauch in der Mutter-Kind-Beziehung ausblendet und die aufopfernde Mutterliebe verherrlicht. Auf gesellschaftlicher Ebene veranschaulicht die Autorin diese Dynamik anhand des Judenhasses im Nationalsozialismus. Die Projektion, Juden und Jüdinnen würden eine Weltherrschaft errichten und alles Nicht-Jüdische unterjochen oder vernichten wollen, reichte als Legitimation zur vorsorglichen Vernichtung.
Fischer hat Biografien von Massenmördern wie Hitler, Himmler, Breivik und einem jungen ISIS-Kämpfer studiert und die beschriebene missbräuchliche Mutter-Kind-Beziehung gefunden. Auch wenn diese psychologische Sicht nicht ausreichen kann, um die Entwicklungen solcher Opfer/Täter*innen zu erklären und schon gar nicht, deren Taten zu legitimieren (man bliebe sonst selbst im Opfer-Täter-Diskurs verhangen), gibt sie einen Hinweis auf die gesellschaftliche Bedeutung solcher früher Beziehungserfahrungen.
Einen Ausweg aus diesen seit Jahrhunderten sich wiederholenden Machtstrukturen im Opfer-Täter-Diskurs sieht Fischer in der Herstellung intersubjektiver Beziehungen, der Wertschätzung der Differenz, die erst tragfähige Beziehungen ermöglicht, wo jede*r ein eigenständiges Ich entwickeln darf, ohne deswegen an der Mutter schuldig zu werden, weil sie dadurch verlassen wird. Das Ausblenden des Gegenübers als eigenständigen und verantwortlichen Mitmenschen sei heute Gang und Gäbe: in der Schule, in Vereinen, Gruppierungen, im Beruf und Militär. Überall herrschen Machtdiskurse vor. Auf politischer Ebene sieht sie die Aufrechterhaltung von Machtstrukturen im Opfer-Täter-Diskurs als schädigend für jede Demokratie. Letztere könne nur dann gelingen, wenn Differenzen gewürdigt statt möglichst ausgelöscht würden.
Ich empfehle dieses vielschichtige Buch gern zur Lektüre.
Peter Schulthess
Anmerkungen
1 Vgl. Besprechung in à jour 2-2021.