Martin Rufer & Christoph Flückiger (Hrsg.). (2020): Essentials der Psychotherapie. Praxis und Forschung im Diskurs Bern: Hogrefe, ISBN: 978-3-456-85923-1, 144 Seiten, 24.95 EUR, 33.90 CHF
https://doi.org/10.30820/2504-5119-2020-1-34
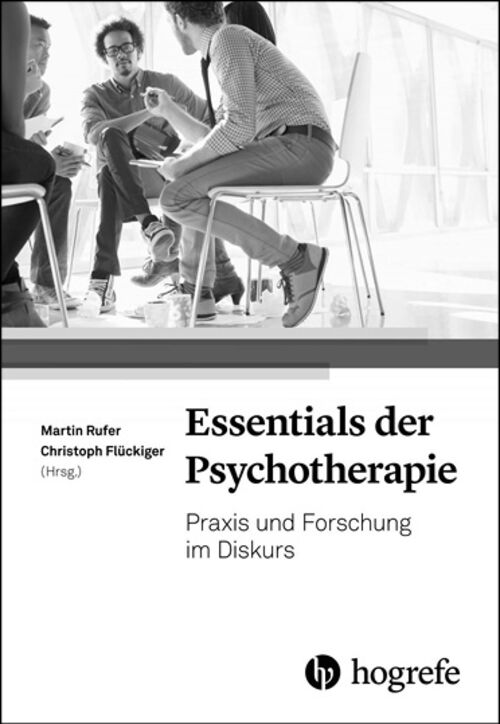
Martin Rufer ist ein «alter Hase» als Praktiker und Lehrer der Systemischen Therapie. Christoph Flückiger ist ein namhafter Psychotherapieforscher, Verhaltenstherapeut und Mitautor des Buches Die Psychotherapie Debatte: Was Psychotherapie wirksam macht (Wampold et al., 2018; vgl. die Buchbesprechung in Psychotherapie-Wissenschaft, 9. Jg., Heft 2/2019). In jenem Buch wird eine Debatte zwischen verschiedenen Forschungsansätzen dargestellt; ein Streit unter Forschern.
Rufer und Flückiger verstehen ihr vorliegendes Büchlein als Fortsetzung dieses Diskurses, diesmal jedoch zwischen Praxis und Forschung. Die Kluft dazwischen ist ja schon verschiedentlich beklagt worden, hier wird jedoch ein spannender Versuch unternommen, sie zu überbrücken, indem Forschende die in jahrzehntelanger Praxis erworbenen Essentials der Psychotherapie von fünf Praktizierenden unterschiedlicher Richtungen kommentieren. (Wobei leider nur die Systemische Therapie, die Verhaltenstherapie und in einem Fall auch die Analytische Psychologie zum Zug kommen. Schade! Die Psychotherapielandschaft ist gerade in der Schweiz – woher die beiden Herausgeber stammen – und in Österreich vielfältiger als in Deutschland.)
Dennoch, das Experiment dieses Buches ist spannend. Zu Wort kommen immer erst die Praxisvertreter*innen, dann im darauffolgenden Kapitel je ein bzw. eine Forschungsvertreter*in. Fünf Autor*innenpaare wurden so zu unterschiedlichen Themen gebildet. Den Abschluss bildet eine Diskussion der beiden Herausgeber im Sinne eines Summarys.
Das Anliegen des Buches ist es, in der Wissenschaft wohl zu wenig beachtetes Praxiswissen mit der Forschung zu verbinden und so einen Beitrag für ein kooperatives «Practitioner-Scientist»-Modell auf Augenhöhe zu leisten. Je ein unterstützendes Vorwort dazu steuern Eva-Lotte Brakemeier und Louise Reddemann bei.
Den Auftakt macht Martin Rufer. Er zieht in seinem Beitrag Bilanz aus seiner circa 40-jährigen Berufstätigkeit und beschreibt Essentials, die ihm mit zunehmender Erfahrung wichtig wurden. Er stützt sich in seiner Arbeit auf die Theorie der Selbstorganisation und streicht die Bedeutung des Vertrauens und der Neugierde seitens des Therapierenden heraus. Seine Ausführungen illustriert er mit Fallbeispielen.
Ulrike Dinger diskutiert seinen Beitrag unter dem Titel «Vertrauen und Selbstwirksamkeit aus Sicht der Psychotherapieforschung». Sie stellt einleitend fest, dass es genügend Evidenz gebe, dass eine gute therapeutische Beziehung mit einem positiven Therapieergebnis einhergehe, dass aber die Forschung zum Einfluss des Selbstwirksamkeitsstrebens noch in den Kinderschuhen stünde. Für die aus der Praxis gewonnenen Essentials von Rufer findet sie wissenschaftliche Belege.
Annette Kämmerer nutzt die Gelegenheit, als Praktikerin grundlegend über Psychotherapie nachzudenken. Sie beleuchtet die Themen «Psychotherapie und die Menschenwürde», «Das therapeutische Menschenbild» sowie «Leidensdruck und Psychotherapie» in sehr differenzierter Weise.
Christoph Flückiger antwortet als Forscher auf sie mit «Professionalisierung, Therapeutenbild und Herausforderungen – Nachdenken über Psychotherapeutinnen». Er zeigt den Wandel der Professionalisierung der Psychotherapie im Verlauf der letzten 100 Jahre auf, referiert Forschungsbefunde aus Wampold et al. (2018) und beschreibt Herausforderungen für Psychotherapeut*innen im modernen biopsychosozialen Modell. Sein Schlusssatz gehört zitiert: «Psychotherapie [stellt] weit mehr dar als die ‹Verabreichung› lege artis durchgeführter Interventionen. Sie ist und bleibt sowohl humane Intervention als auch Humanintervention – sowohl für Patientinnen als auch für Therapeutinnen!» (S. 65).
Der nächste Praxisbeitrag stammt von Hans Lieb: «Individualität und Verallgemeinerung in der Fallkonzeption», der das Spannungsverhältnis zwischen fallbezogenen Einzeldaten und deren therapieleitenden Verallgemeinerungen beleuchtet und seine Arbeitsweise mit anschaulichen Fallvignetten illustriert.
Günter Schiepek reagiert darauf in seinem Beitrag mit «Kein Klient ist der ‹Fall› von irgendwas – Das Spannungsfeld von individueller Fallkonzeption, Prozessteuerung und Verallgemeinerung». Er plädiert für Einzelfallorientierung und stellt sein Modell der täglichen Datenerhebung mittels einer App, der Prozessteuerung und der Verallgemeinerung als Theorie mit Einzelfallbezug vor. Dafür stützt er sich theoretisch auf die Chaostherapie und die Synergetik und macht damit deutlich, warum Entwicklungsdynamiken nur sehr begrenzt oder gar nicht vorhersehbar und auch nicht linear steuerbar seien.
Dirk Zimmer schreibt über den «Aufbau positiven Denkens im Spannungsfeld von Selbstabwertung, Selbstzweifeln und Selbstakzeptanz». Er sieht Psychotherapie als unterstütztes Lernen, spricht sich allerdings gegen Manuale aus, die lediglich der Forschung dienten, in der therapeutische Arbeit aber durch individualisiertes Vorgehen ersetzt werden müsse. Zum Aufbau eines positiven Selbstbildes offeriert er Übungen in fünf Schritten.
Ulrike Willutzki, zu deren Fach- und Forschungsgebiet das ressourcenorientierte Arbeiten gehört, kommentiert wohlwollend den Beitrag Zimmers mit ihrem Aufsatz «Respektvoll, behutsam und genau …» und streicht die Bedeutung des genauen Hinhörens und einer bescheidenen, selbstreflexiven Haltung des Therapierenden heraus. Auch ihr Schlusssatz gehört zitiert: «Auch wenn wir das, was wir tun, Interventionen nennen: Wir intervenieren als Therapeutinnen nicht, sondern in Abstimmung auf den Selbstorganisationsprozess unserer Patientinnen schaffen wir einen Rahmen, in dem sich diese in eine für sie hoffentlich glücklichere Richtung bewegen können» (S. 113).
Unter dem Titel «Alles allgemein menschlich? Alles kulturbedingt? – Eine produktive Verwirrung!» schneidet Verena Kast das Thema der interkulturellen therapeutischen Arbeit an. Sie folgt einem Fallbeispiel eines japanischen Supervisanden, der eine Therapie mit einer Japanerin macht, die mit einem Schweizer verheiratet ist. Sie arbeitet schön heraus, wie kultursensitiv man als Supervisor*in und Therapeut*in vorgehen müsse, um nicht in die Falle von Identifikationen mit den eigenen kulturellen Werten zu geraten. Sie fordert dazu auf, die westliche Kultur nicht als weltweit dominant und deren Werte für universell anzusehen, sondern auf Augenhöhe den Dialog mit Menschen zu führen, die durch eine andere Kultur geformt sind.
Maria Borcsa kommentiert den Beitrag mit folgender Überschrift: «Das Infragestellen des Selbstverständlichen – wenn das Fremde in den Blick gerät». Sie streicht heraus, dass es in der transkulturellen therapeutischen Praxis wichtig sei, gemeinsam die Funktionen der unterschiedlichen Formen von Bindungsverhalten in den jeweiligen Kulturen zu ergründen und somit aus einem unhinterfragten Verhaltensrepertoire zu externalisieren.
Im zusammenfassenden Gespräch stellen Martin Rufer und Christoph Flückiger fest, dass es eine hohe Übereinstimmung der Autor*innen gebe und dass die verallgemeinerte Diagnostik für den therapeutischen Alltag nicht so zentral sei, sondern vielmehr das individualisierte Vorgehen, das Erkennen dieses einzelnen und einmaligen Menschen, der da in Therapie kommt, in seinen Ressourcen und seinem Leiden. Unter dem Gesichtspunkt der Psychotherapie als Profession sei klar, dass Psychotherapeut*innen der Allgemeinheit jedoch in irgendeiner Form Rechenschaft ablegen müssen, was sie tun, ohne das Patient*innengeheimnis zu verletzen. Es stelle sich also die Frage nach der Erfassung und Sicherung der Qualität psychotherapeutischer Arbeit.
Interessant sei auch, dass die Forschung ihren Interessensschwerpunkt verlagere und die Frage nach Therapeut*inneneffekten in den Vordergrund rücke. Sie würden immerhin zwischen fünf bis zwölf Prozent der Therapieergebnisse erklären.
Schliesslich sind sich Rufer und Flückiger auch bewusst, dass in diesem Buch vorwiegend ältere Psychotherapeut*innen zu Wort gekommen seien und die Stimme der Jüngeren fehle, die die Gesellschaft doch immer wieder an ihre Essentials erinnern und dadurch weiterentwickeln würden.
Ich wünsche dem Buch eine gute Verbreitung in Lehre und Fortbildung. Diese Form der Verbindung von Praxis und Forschung ist vielversprechend und sollte als Modell weitergeführt werden.
Peter Schulthess